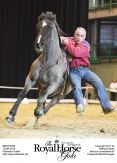Knabstrupper „Auf den Punkt gebracht“
Pipi Langstrumpf-, Dalmatinerpferde, Barocktiger, oder Pferde aus Licht und Schatten? Alles passt, oder auch gar nichts. Knabstrupper gibt es in allen Formen und Farben und entgegen der landläufigen Meinung gehören die Tupfen noch nicht einmal immer dazu! Warum die auffällige Fellfarbe ausgerechnet nach einem Tiger und nicht nach dem viel näher liegenden Leopard benannt wurde- darüber sollte man erst gar nicht nachdenken.
Einfarbige braune, schwarze oder fuchsfarbige Knabstrupper muss es ebenfalls geben, weil man bei der Anpaarung zweier getupfter Tigerschecken 33% einfarbige Fohlen erhält. Dann gibt es auch noch die Weißgeborenen mit dunklen Augen, die in Wirklichkeit Tigerschecken mit minimalen Farbtupfern sind. Egal welcher Form und Farbe. Die meisten Leute sind vor allem von der Farbvielfalt dieser Rasse begeistert- auch wenn die fast einfarbigen Pferde interessanter Weise gerade unter den Knabstruppern als besonders wertvoll gelten. Ursprünglich als edle Reittiere für den barocken, dänischen Königshof gezüchtet, sieht man sie heute ab und zu auch als elegante moderne Dressurcracks durchs Viereck schweben oder bunte Sprünge überwinden. Was versteht man denn nun genau unter einem Knabstrupper?
Knabstrupper entstanden um Ende des 17. Jhd. als Farbvariante des bodenständigen dänischen Warmblutpferdes, dem Frederiksborger. Man bemühte sich damals intensiv um die Zucht möglichst vieler weißgeborener, auch Atlasschimmel oder Perlfarben genannte Pferde. Diese exklusiven Tiere gingen als Königspferde in alle Herren Länder und machten die dänische Pferdezucht berühmt. Aufgrund einer zu hohen Inzuchtrate gab es aber bei den Weißgeborenen im Laufe der Zeit so große Fruchtbarkeitsprobleme, dass die Zucht 1871 aufgelöst werden mußte und die Tigerschecken nur noch in Gut Knabstrup, das den Pferden ihren Namen gab, weitergezüchtet wurden. 1891 starben bei einem Brand die besten Zuchttiere und mit der verbleibenden Handvoll Tigerschecken bemühte man sich, die Linien aufrecht zu erhalten. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage zu Beginn des 20.Jhd. sah man sich gezwungen, schwerere Schläge einzukreuzen, um ein vielseitig einsetzbares Nutzpferd zu produzieren. Die Kriegswirren machten es unmöglich, die Stutbücher weiterzuführen und der barocke Knabstrupper von einst existierte nur noch äußerst selten. Verschiedene Autoren erwähnen Einkreuzungen vom Vollblut, über schwere Warmblüter bis hin zum Pony und in Folge dieser planlosen Kreuzungszucht kam es zu erheblichen Qualitätseinbußen und einer unglaublichen Varianz an Größen. So recht kann also niemand beurteilen und schon gar nicht wissen, welche Urahnen die heutigen Knabstrupper überhaupt haben.
In Deutschland befinden sich inzwischen rund 400 Knabstrupper, von denen ca. 200 in der Zucht stehen. Neben der umfangreichen Farbpalette existieren drei Typenbeschreibung: Der moderne, einem Deutschen Reitpferd nahestehende, der barocke, einem Iberer entsprechenden Pferd und der Ponytyp.
Lusitanos „Nervenstarke Kämpfer“
Iberische Pferde kommen nicht nur aus Spanien! Auch wenn sie auf gemeinsame Wurzeln zurückblicken, sind die reinblütigen portugiesischen Lusitanos (Puro-Sangue Lusitano) seit Trennung der Stutbücher 1967 eine eigenständige Rasse. Vorher war es egal, zu welcher Seite der Grenze ein Pferd aufgewachsen war- es galt einfach als „Iberer“. Es dauerte lange, bis der Lusitano nicht nur aus dem Schatten der Vergangenheit, sondern auch aus dem Schatten seines spanischen Bruders heraustreten konnte. Heute beeindruckt er seine Anhänger durch ihren wunderbaren Charakter, ihren Mut und Unerschrockenheit, ihre Leistungsfähigkeit und natürlich durch ihre spezielle Eignung für die klassische Reitkunst.
Das „Urpferd“ der Iberischen Halbinsel wurde 1920 im Gebiet zwischen den Flüssen Sôr und Raia „wieder entdeckt“. Diese unscheinbaren, mausgrauen Sorraias entsprechen wahrscheinlich genau dem Pferdetyp, der die Grundlage erster menschlicher Zuchtversuche war. Ergebnis der Bemühungen war ein besonders wendiges, nervenstarkes Kriegspferd für den Nahkampf. Bereits in der Antike bewunderte man die iberischen Krieger aufgrund ihrer effektiven Kampftechnik. Ihre tollkühnen Jagden auf Wildrinder beeindruckten sogar Platon: „Der Brauch, den Stier vom Pferd aus zu bekämpfen ist einzigartig auf dieser Welt...“ Die überlegenen Pferde lehrten später auch die Römer das Fürchten. Sie lernten von den Iberern, übernahmen Rassetypus und Reitweise, kultivierten den Stierkampf zu Pferde und förderten die Pferdezucht auf breiter Basis. Auch unter den maurischen Besatzern entwickelte sich der Bestand weiter. Als die Maueren 1492 endgültig besiegt wurden, begann die Hochzeit der iberischen Pferdezucht, die in Portugal bis ins 19.Jahrhundert anhielt. Form und Funktion der Pferde blieben dabei unverändert: Eignung für die traditionelle Kampfreitweise, für Klassische Reitkunst und für den berittenen Stierkampf, der in Portugal nichts mit dem spanischen gemein hat.
Alle Beteiligten (auch der Stier!) verlassen lebend die Arena. Das farbenfrohe Spektakel, bei dem die Reitkunst im Mittelpunkt steht, wird nach genauen Regeln ausgetragen. Jahrelang trainierte Lektionen der Hohen Schule dienen dazu, den Stier zum Angriff zu provozieren. Die Unversehrtheit von Reiter und Pferd hängt stets am Geschick des jeweiligen Partners. Ein gutes Stierkampfpferd muss gehorsam, geduldig und durch nichts zu beeindrucken sein. Es braucht jede Menge Persönlichkeit, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, muss energisch, beweglich, wendig, einfühlsam und schnell sein. Damit definiert sich das Zuchtziel dieser portugiesischen Pferde und deshalb sind Lusitanos auch „anders“ als die anderen Barockrassen: Vielfach beweglicher und reaktionsschneller vermittelt ihre runde Erscheinungsform den Eindruck eines elastischen Gummiballes, der sich zu jedem Zeitpunkt in alle Richtungen hin bewegen kann.
Selbst bei extremen Seitwärtsbewegungen ermöglicht eine spezielle Skelettwinkelung besonders hohe und gleichzeitig raumgreifende Bewegungen- wichtig bei Ausweichmanövern. Lange, schräge Fesseln wirken dabei wie Stoßdämpfer und vermitteln dem Reiter trotz aller Mobilität ein angenehmes Sitzgefühl.
Die Schnellkraft der Lusitanos macht sie auch zu passablen Springpferden. Tatsächlich belegte der Hengst Novilhero unter John Whitaker einmal Platz 12 der Weltrangliste, während Felix Brasseur 1994 die Mannschaftssilbermedalie bei der Fahrer WM mit einem Lusitanovierspänner errang. Er hatte die Pferde sechs Monate vorher zum ersten Mal gesehen und war überzeugt davon, dass er mit keiner anderen Rasse in derart kurzer Zeit diesen Ausbildungsstand erreicht hätte. Ein Jahr später gewannen die Lusitanos dann die Vierspänner- WM in Belgien.
Araber „Trinker der Lüfte“

Als Gott das Pferd erschaffen hatte, sprach er zu dem herrlichen Geschöpf:
“Dich habe ich gemacht ohnegleichen. Alle Schätze der Erde liegen zwischen deinen Augen...Ich habe dir die Macht verliehen, zu fliegen ohne Flügel. (KORAN)
Und Allah nahm eine Handvoll Südwind, hauchte ihm seinen Atem ein und erschuf so das Pferd (Beduinenlegende).
Der Araber gilt als edelste Rasse der Welt und ist ein beliebtes Freizeitpferd. Trotz seines Temperaments ist er sehr menschenbezogen und für manche Reiter schon wegen der Optik “DAS Pferd schlechthin”.
Über den Ursprung des Arabers kursieren viele Theorien. Manche verfolgen die Entstehung der Rasse zurück bis 3000 v.Chr. Basierend auf die Pferde der Ägypter und Assyrer brachte der Prophet Mohammed (579-632) die Zucht zu einer großen Blüte. Pferdehaltung wurde zum Grundsatz des islamischen Glaubens. Die besten “asilen” (=unvermischten) Araber stammen von Nomaden im arabischen Hochland.
Hartes Klima, karge Nahrung, erbarmungslose Auslese und fanatische Reinzucht mit hohen Inzuchtanteilen erschufen ein relativ kleines (bis ca. 1,50 cm Stockmaß) Pferd mit unvergleichlichen Qualitäten. Zahllose Legenden beschreiben Intelligenz, Charakter, Ausdauer, Kühnheit und Schnelligkeit der arabischen Pferde- Eigenschaften, die das Überleben der kriegerischen Besitzer garantierten. Dabei war für die Beduinen die Schönheit der Pferde Nebensache. Für sie zählte nur Leistung. Während der zunehmenden Islamisierung kam der Araber mit den Mauren über die Iberische Halbinsel auch nach Europa. Als Veredler nahezu aller Pferderassen eroberte er schließlich erfolgreich die ganze Welt. Besonderen Einfluß hatte der Araber bei der Entstehung des Englischen Vollblutes, dem meist verwendeten Pferd für Galopprennen. Die Kreuzung beider Rassen, der Anglo-Araber, hat viel Springvermögen und wird vor allem in England und Frankreich erfolgreich in der Sportpferdezucht eingesetzt. Part-Breds, Halbblüter aus diversen Rassen mit verschieden hohem Araberanteil sind oft sehr harmonische, hübsche Pferde mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
Arabische Pferde setzt man heutzutage in allen Sparten der Reiterei ein. Im Wettkampf mit anderen Rassen bewähren sie sich mit rassetypischer Ausdauer und Härte besonders im Distanzsport. Araber sind extrem reaktionsschnelle, hoch im Blut stehende Fluchttiere mit hoher Intelligenz und Lernfähigkeit. Sie brauchen besonders sensible Reiter, die damit produktiv umgehen können, ohne dass die Pferde zu heiß werden.
Araber sind auch sehr neugierig und wollen sehen, was um sie herum vor sich geht, weshalb man ihnen stets genügend Möglichkeiten geben sollte, sich umzusehen, ohne sie ständig zu disziplinieren. Im allgemeinen gibt es eine einfache Regel, Araber ruhig zu reiten: Lassen Sie sie einfach in Ruhe!”
Andalusier „Pura Raza Espanola – Adel pur“
Während der Begriff “Andalusier” keine korrekte Rassebezeichnung ist und oft für spanische Pferde ohne Papiere Verwendung findet, versteht man unter der Pura Raza Espanola (PRE) rund 35000, beim spanischen Verteidigungsministerium in der Abteilung “Cria Caballar (Pferdezucht)” registrierte und eingetragene Rassepferde.
Auch wenn das moderne Stutbuch erst 1912 gegründet wurde, so gilt die PRE als eine der ältesten Rassen der Welt. Hervorgegangen aus regionalen iberischen Pony- und Pferdeschlägen, gemischt mit etwas nordafrikanischem Berberblut trug die Rasse erheblich zur Entstehung und Verbesserung vieler europäischer Schläge bei. Trotz vieler früherer Wurzeln entfaltete sich die spanische Pferdezucht zunächst im Mittelalter. Viele adelige Familien züchteten ohne einheitlichen Typ nach eigenen Vorstellungen.
Eng verknüpft mit der wechselvollen Geschichte der Karthäusermönche begann damals auch die Zucht der Cartujanos oder Karthäuserpferde, einer legendären, besonders edlen Elitegruppe unter der PRE-Population. Bis zum heutigen Tag schmückt sich der Adel genau wie vor Jahrhunderten mit diesen edlen Tieren. 1446 vererbte ein Pferdezüchter und Gönner dem Orden in Jerez de la Frontera ca. 40 km² Land, auf dem die Mönche ihre bisher auch in Sevilla betriebene Zucht mit besonders qualitätsvollen andalusischen Pferden ausweiten konnten. Die Herden wuchsen an, als z.B. verarmte Edelleute ihre Schulden mit weiterem erlesenen Zuchtmaterial beglichen. Nach Plünderung und Zerstörung des Gestütes in Sevilla wachten die Mönche umso eifriger über ihre Pferde. Während der Barockzeit erlebte das Spanische Pferd an den Europäischen Fürstenhöfen seine absolute Glanzzeit und wäre im 17. und 18. Jhd. fast gänzlich untergegangen, als Napoleon den Spaniern per königlichem Edikt befahl, größere und schwerere Pferde einzukreuzen. Nur die Mönche wagten es, sich diesem Befehl strikt zu widersetzen und heimlich weiter zu züchten. Geschickt versteckten diese Puristen die Tiere. Durch Sturheit und Einfaltsreichtum schafften sie es tatsächlich, ihre “Karthäuserpferde” rein zu erhalten und wurden damit “die Gralshüter des iberischen Pferdes”, denn diese Tiere bildeten das Fundament der heutigen PRE-Zucht.
Der Rassestandard ist mittlerweile vereinheitlicht: Pura Raza Espanola-Pferde sind mittelgroß (1,55-1,62 m), wirken überaus harmonisch und sind äußert rittige, für starke Versammlung prädestinierte, muskulöse Pferde mit überwiegender Schimmelfarbe. Sie haben langen, dichten Behang, viel Halsaufsatz und eine melonenförmige Kruppe mit tief angesetztem Schweif, der kaum getragen wird.
Neben dem “subkonvexen” Profil, einer relativ gerade verlaufenden, nur gegen die Nüstern hin mehr oder weniger abfallenden Nasenlinie, bestechen sie durch erhabene, kadenzierte Gänge, eine hohe Aktion mit gleichzeitigem Raumgriff, robuste Gesundheit und ein exquisites, nervenstarkes Interieur, das Aggressionen auch unter den Hengsten weitestgehend einschränkt und die Pferde extrem menschenbezogen macht. Charakter und Adel, gepaart mit hervorragenden Bewegungen machen diese Rasse zu absoluten „Traumpferden“.
Lipizzaner "Weiße Pferde in grüner Oase"
Ohne die weltberühmten Lipizzanerschimmel, denen der kleine slowenische Ort Lipica seinen Namen gab, wäre der einstige Sommersitz der Triester Bischöfe wohl im Dunkel der Geschichte verschwunden. Auch wenn die Region rund um das Dorf schon immer mit einigen klimatischen und landschaftlichen Besonderheiten aufwarten konnte, so wurden diese natürlichen Vorzüge vom Menschen speziell für die Pferdezucht seit über 400 Jahren systematisch ausgebaut und gepflegt. Nach den Türkenkriegen, die Lipica völlig verwüsteten, gelang es dem österreichischen Erzherzog Karl II. 1580, das Gut den Triester Bischöfen abzukaufen. Auch die österreichische Monarchie benötigte nach der Erfindung des Schießpulvers anstelle der schweren, gepanzerten Schlachtrösser schnelle, wendige Reitpferde für die Kavallerie. Die bisher gebräuchlichen, äußerst repräsentativen, spanischen Pferde waren selbst für gekrönte Häupter nahezu unerschwinglich geworden und man sah sich gezwungen, einen Ersatz zu finden. Der karge Karst ähnelte dem Gebiet in Andalusien, das bisher die besten und edelsten Rösser an die Königshäuser in ganz Europa geliefert hatte. Lipica schien trotz seiner fernen Lage zur den österreichischen Machtzentren ein idealer Ort für eine eigene Pferdezucht des Herrscherhauses zu sein.
Mit neun spanischen Hengsten und einheimische Karststuten begann die planmäßige Zucht der Lipizzaner. Seine Blütezeit hatte Lipica während der Regierung Kaiser Karls VI. (1711?1740) und seiner Tochter Maria Theresia (1740?1780). Die Rasse hatte sich konsolidiert und der Lipizzaner entsprach mit seinen kompakten, rundlichen Formen und konvex gebogenen Nasenrücken dem barocken Zeitgeschmack. Die Zahl der Zuchtstuten stieg auf 150 an.
Fünf Stempelhengste bildeten die klassischen Linien:
- „Pluto“ vom dänischen Gestüt Frederiksborg begründete kräftige Pferde mit
nur leichter Ramsnase
- Der braune „Neapolitano“ und der Rappe „Conversano“, beide Nachfahren der schweren, italienischen Neapolitanos haben erhabene Gänge sowie schwere, deutlich ausgeprägte Ramsköpfe
- Kladruber „Maestoso“ zeugte Pferde mit langem Rücken und kräftiger Kruppe
- Nachkommen des Falben „Favory“, ebenfalls ein Kladruber, weisen einen feineren Körperbau auf
- Araber „Siglavy“ begründete zu Beginn des 19. Jahrhunderts die sechste Linie. Ihr fehlt die betont hohe Aktion, die Kopfform ist gerade, der Rücken kürzer bei höherem Widerrist.
1735 wurden im neu errichteten Bau der Spanischen Hofreitschule in Wien neben den spanischen Pferden erstmals Lipizzaner vorgestellt ? eine große Anerkennung für das Gestüt und eine Herausforderung zugleich. Hatte man bisher überwiegend Prunk? und Paradepferde für Adel, Kavallerie und den Hof geliefert, so sollte der Lipizzaner auf einmal den anspruchsvollen und speziellen Erfordernissen der Spanischen Hofreitschule gerecht werden. Nur besonders talentierte, dreijährige Hengste kamen nach Wien, zurück kehrten alte, in der Reitschule bewährte Hengste, von denen man zweifelsfrei annehmen konnte, dass sie für hochwertigen, charakterlich einwandfreien Nachwuchs sorgen würden. Aus dieser Zeit stammt auch der Brauch, für nach Wien geschickte Pferde drei Bäume zu pflanzen. So entstanden im Laufe von 350 Jahren die großen Gestütsalleen. Heute bezieht die Reitschule ihre Hengste aus dem österreichischen Bundesgestüt Piber.
Lipica hatte immer wieder unter den Wirren kriegerischer Auseinandersetzungen zu leiden. Nach dem zweiten Weltkrieg kehrten 1947 nur elf Pferde in das fast völlig zerstörte Gestüt zurück. Heute hat sich der Bestand wieder gut erholt. Etwa 160 Zuchtpferde und Fohlen grasen momentan gemeinsam mit 40 Reitpferden im Schatten der 100? und 200-Jahre alten Steineichen. Jahr. Als besonderes "Qualitätsmerkmal" erhalten alle im Stammgestüt Lipica geborenen Lipizzaner ein "L" auf die linke Backenseite gebrannt. Bis ins letzte Jahrhundert gab es die Lipizzaner in allen Fellfarben, dann kamen die k. und k. Schimmel in Mode und die weiße, sich dominant vererbende Farbe wurde zum Rassemerkmal der Lipzzaner. Die wenigen dunklen Pferde sind absolute Raritäten und gelten als besonders wertvoll. Alle Schimmel kommen jedoch zunächst mit dunklem Fell zur Welt. Bei jedem Fellwechsel werden sie heller und sind dann zwischen sieben und zehn Jahren silberweiß. Auch wenn die Rasse als Dressurpferd schlechthin gilt, so bewährend sich Lipizzaner darüber hinaus überaus erfolgreich im internationalen Fahrsport. Die Ungarn holten mit den Kaiserschimmeln bereits mehrfach den Weltmeistertitel in ihr Land.
Friesen „Black is beautiful“
Wie sehen Pferde aus, die durch Mädchenträume in aller Herren Länder galoppieren? Es sind kraftvolle Erscheinungen mit majestätischem, aber dem Menschen stets zugewandten Auftreten, langen, wehenden Mähnen, Adel, Kraft und Anmut mit sanftem Blick aus dunklen Augen. Das alles am besten in der unschlagbaren Version “schwarzer Hengst“. Friesen bedienen alle diese Klischees aufs Beste. Sie entwickelten sich zu einer der beliebtesten Moderassen unserer Zeit mit Nachzuchten auf allen fünf Kontinenten. Dass es sie heute überhaupt noch gibt- als einzige noch bestehende original niederländische Pferderasse und noch dazu in Reinzucht- grenzt fast an ein Wunder, hat aber eher mit dem leidenschaftlichen Engagement einiger echter Pferdeleute zu tun, die nicht nur ihr Herz für diese Tiere entdeckten, sondern ihren Enthusiasmus auch erfolgreich und kompetent an ein breites, internationales Publikum weitergeben konnten.
Innerhalb kürzester Jahre avancierten Friesen zum festen Bestandteil von Zirkus und Show und gehören zu den wenigen Rassen, die dank ihres einheitlichen Typs selbst für Laien einen hohen Wiedererkennungswert haben.. Vergleicht man den heutigen Friesen mit der Darstellung der Pferderasse Phrysos aus dem Jahre 1568 wird deutlich, dass das Friesenpferd als eine der wenigen lokalen Landpferderassen Europas seinen Typus über Jahrhunderte lang nahezu unverändert erhalten konnte. Das ehemalige Schlachtross des frühen Mittelalters, dem die Ritter zumuteten, rund 350kg zu schleppen, veredelte man Anfang des 17. Jahrhunderts mit orientalischem und iberischem Fremdblut. Dabei wandelte sich der Urfriese zum schweren, dabei jedoch eleganten und repräsentativen Reit- und Fahrpferd. Seit 1943 werden die Tiere in das geschlossene „Friesch Paarden Stamboek“ (= F.P.S.) eingetragen. 1949 übernahm Königin Juliane die Schirmherrschaft und verlieh der Züchtergenossenschaft 1954 das Prädikat „königlich“.
Trotz ihrer Intelligenz und Lernwilligkeit bleiben die attraktiven Rappen bisweilen fast zu gelassen. Manche Menschen würden diese Eigenschaft vielleicht als „büffelig“ bezeichnen- andere wiederum sind froh, ein Gemütspferd zu besitzen. Der fromme Charakter des Friesen erleichtert zusätzlich die Verwirklichung des Traumes vom eigenen schwarzen Hengst im Stall: Bei allem Temperament ist er extrem menschenbezogen, zutraulich und ehrlich. Am Markantesten ist aber –neben der schwarzen Fellfarbe- das energische, schwungvolle Gangwerk mit hoher Knieaktion. Der Friese ist ein prachtvolles Wagenpferd, dank des einheitlichen Typs prädestiniert für mehrspänniges Fahren.
Darüber hinaus glänzen sie bei versammelten und zirzensischen Lektionen. Wo auch immer die schwarzen Perlen auftreten: Überall lassen sie die Herzen höher schlagen. Ihre hoch aufgesetzte Halsung, die spektakuläre Aktion, der wehende Behang und das üppige Langhaar faszinieren Pferdefreunde auf der ganzen Welt.